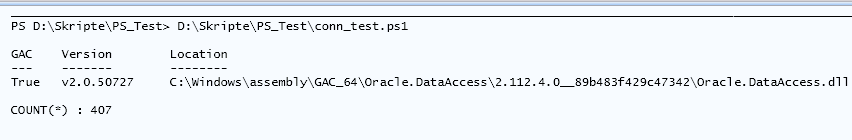Das Duplizieren von Datenbanken auf einem RAC ist gar nicht so schwer.
Das erste, was man sich vergegenwärtigen muss, wenn man auf dem RAC eine DB clonen/duplizieren möchte ist: Es ist
im Prinzip das gleiche wie auf einem "normalen" Server - normal meint hier: Single-Node - nur irgendwie komplizierter. Aber wen wundert das schon. ;)
Im Prinzip steht alles, was man wissen muss hier drin:
Oracle® Database Backup and Recovery User's Guide
Speziell diese Kapitel sollen helfen:
Wer schon einmal eine DB auf einem "normalen" Server dupliziert hat, der weiß
im Prinzip schon alles. Er musste dabei auf diverse Details seiner Systemumgebung achten - zum Beispiel:
- Wird von ASM nach ASM, von ASM ins Filesystem oder umgekehrt dupliziert?
- Wird OMF von target oder von auxiliary oder von beiden genutzt?
- Duplizieren wir "backup based", "without/with target connection", "with/without recovery catalog" oder lieber nur "from active database"?
- ...Hä? ;)
...und das Ganze jetzt auch noch auf dem RAC...
Das Wichtigste gleich vorneweg:
Es ist
unmöglich von RAC-DB zu RAC-DB zu duplizieren.
Aber: Man kann eine RAC-DB in eine Single-Instance-DB duplizieren und diese anschließend zu einer RAC-DB machen.
Na geht doch.
Ausgangslage
Ich mache es mir einfach:
Wir haben einen 2-Knoten-RAC mit ASM und OMF - keine ausgefallenen Geschichten. Im Falle eines Standard-Edition-Systems und noch dazu auf Windows sollte dies in 99% der Fälle passen.
Auf dem RAC läuft die zu duplizierende DB (target), die auf dem selben RAC dupliziert werden soll. In der ASM ist genug Platz. Die DB läuft im Archivelog-Modus und ein RMAN-Backup ist eingerichtet.
Die Duplizierung läuft "backup based", "with target connection" und "without recovery catalog".
Das Server-OS ist (leider) ein WindowsServer 2008 R2. (englisch)
Vorbereitung
Die neue Instanz (auxiliary) muss eingerichet werden. Hierfür sind eine Reihe von Schritten notwendig.
1. Dienst und Passwortdatei anlegen
D:\>set ORACLE_HOME=D:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1
D:\>oradim -new -sid DUPLO
Instanz erstellt.
D:\>orapwd file=d:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1\database\pwdDUPLO.ora
password=<SYSPWD>
Es bietet sich an, hier das gleiche Passwort zu nutzen, wie in der target-DB.
2. Parameterfile anlegen
Am besten kopiert man die init.ora der target-Instanz und kommentiert alle RAC-Parameter aus oder entfernt sie.
Für eine initiale Duplizierung sind nur wenige Parameter notwendig.
#initDUPLO.ora
### notwendige Parameter ###
db_name='DUPLO'
db_create_file_dest='+DATA'
#Falls Datafile-Konvertierungen nötig sind: DB_FILE_NAME_CONVERT
#DB_FILE_NAME_CONVERT='+DUPSOURCE','+DUPDEST'
control_files='+DATA(CONTROLFILE)/duplo/duplo_control01.ctl','+FRA(CONTROLFILE)/duplo/duplo_control02.ctl'
db_recovery_file_dest='+FRA'
db_recovery_file_dest_size=52428800000
#Falls Logfile-Konvertierungen nötig sind: LOG_FILE_NAME_CONVERT
#LOG_FILE_NAME_CONVERT='+DGDUPSOURCE','+DGDUPDEST'
log_archive_dest='+FRA'
### Hier die RAC-Parameter ###
cluster_database=false
#cluster_database_instances=2
#duplo1.instance_number=1
#duplo2.instance_number=2
### optionale Parameter ###
db_domain=''
db_block_size=8192
sga_target=3969908736
pga_aggregate_target=1323302912
log_archive_format='ARC%S_%R.%T'
db_create_online_log_dest_1='+FRA'
archive_lag_target=1800
[edit] hinzugefügt am 10.09.2013:
3. Die Datenbank und die Instanz in der Clusterware registrieren
Auf einem normalen DB-Server ohne Grid-Infrastruktur macht man die Instanzen über einen Eintrag in der listener.ora bekannt.
Auf dem RAC bemüht man eine Reihe von srvctl-Kommandos:
D:\>set ORACLE_HOME=D:\oragrid\11.2.0.3
D:\>srvctl add database -d DUPLO -o d:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1\ -c SINGLE -x racnode01
rem D:\>srvctl add instance -d DUPLO -i DUPLO -n racnode01
D:\>srvctl config database -d DUPLO
Eindeutiger Datenbankname: DUPLO
Datenbankname:
Oracle-Standardverzeichnis: d:\oracle\pr
Oracle-Benutzer: nt authority\system
Spfile:
Domain:
Startoptionen: open
Stoppoptionen: immediate
Datenbankrolle: PRIMARY
Verwaltungs-Policy: AUTOMATIC
Server-Pools: DUPLO
Datenbankinstanz: DUPLO
DatentrΣgergruppen:
Mount Point-Pfade:
Services:
Typ: SINGLE
Die Datenbank ist administratorverwaltet
[/edit]
4. spfile anlegen
Zunächst startet man die Instanz der auxiliary-DB im nomount-Modus und erzeugt das spfile in der ASM.
Instanz starten:
D:\>set ORACLE_SID=DUPLO
D:\>set ORACLE_UNQNAME=DUPLO
D:\>sqlplus /nolog
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Di Jun 11 20:16:35 2013
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.
SQL >conn / as sysdba
Bei einer nicht hochgefahrenen Instanz angemeldet.
SQL >startup nomount pfile='D:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1\database\initDUPLO.ora';
ORACLE-Instanz hochgefahren.
Total System Global Area 3958439936 bytes
Fixed Size 2261280 bytes
Variable Size 771755744 bytes
Database Buffers 3170893824 bytes
Redo Buffers 13529088 bytes
11.06.13 SYS AS SYSDBA@DUPLO>
SPFILE in der ASM erzeugen:
SQL >create spfile='+DATA' from pfile='d:\oracle\product\
11.2.0.3\dbhome_1\database\initDUPLO.ora';
Datei erstellt.
Abgelaufen: 00:00:00.32
11.06.13 SYS AS SYSDBA@DUPLO>
Ein must have (1)
Hier halten wir kurz inne und nehmen uns Zeit für ein wenig Feinschliff.
Das spfile wird in der ASM automatisch unter '+DATA/DUPLO/PARAMETERFILE/' angelegt und bekommt wegen OMF einen nicht merkbaren Namen:
ASMCMD [+] > ls +data/duplo/parameterfile/
spfile.303.817894325
Es ist schöner, wenn man mit einem spfile arbeiten kann, das nicht diese Zahlen hat. Wenn man das trotz OMF haben will, ist MKALIAS in ASMCMD das Mittel der Wahl - also ein Link:
ASMCMD [+] > mkalias +DATA/DUPLO/PARAMETERFILE/spfile.303.817894325 +DATA/DUPLO/spfileduplo.ora
Hier sieht man dann schön das Ergebnis:
ASMCMD [+] > ls +data/duplo/
CONTROLFILE/
DATAFILE/
PARAMETERFILE/
duplo_control01.ctl
spfileduplo.ora
ASMCMD [+] >
Hier fehlt noch ein Detail: Die Instanz weiß nicht wo das spfile liegt und bedient sich weiter gemäß den Defaultvorgaben. Dazu aber später mehr.
Die Duplizierung
1. RMAN - connect & duplicate
Jetzt kann man sich mit RMAN einloggen und die DB duplizieren:
D:\>rman target sys/<SYSPWD>@orcl auxiliary /
Recovery Manager: Release 11.2.0.3.0 - Production on Di Jun 11 20:52:29 2013
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Mit Ziel-Datenbank verbunden: ORCL (DBID=4167151783)
Bei Hilfsdatenbank angemeldet: DUPLO (nicht mit MOUNT angeschlossen)
RMAN> duplicate target database to DUPLO until time "TO_DATE('11.06.2013:20:30','DD.MM.YYYY:HH24:MI')";
Starten Duplicate Db um 11.06.13
Kontrolldatei der Zieldatenbank wird anstelle des Recovery-Katalogs verwendet
Zugewiesener Kanal: ORA_AUX_DISK_1
Kanal ORA_AUX_DISK_1: SID=922 Device-Typ=DISK
...
...
Inhalt von Speicher-Skript:
{
Alter clone database open resetlogs;
}
Speicher-Skript wird ausgeführt
Datenbank geöffnet
Beendet Duplicate Db um 11.06.13
RMAN>
An dieser Stelle wäre noch Platz für Nacharbeiten bzw. Umkonfigurieren der DB. (Onlinelogs hinzufügen, Pfadanpassungen...)
2. Aus 1 mach 2 (1)
Das pfile muss jetzt angepasst werden um aus der Singleinstancedatenbank eine RAC-DB machen zu können.
Hierzu werden dien RAC-Parameter in der init.ora editiert. Anschließend wird mit dem pfile das spfile in der ASM erzeugt.
Das reicht aber noch nicht aus. Die DB muss dann in den Cluster integriert werden
RAC-Parameter im pfile:
#initDUPLO.ora
...
### Hier die RAC-Parameter anpassen###
cluster_database=true
cluster_database_instances=2
duplo1.instance_number=1
duplo2.instance_number=2
...
jetzt das spfile erzeugen:
SQL >create spfile='+DATA/DUPLO/spfileduplo.ora' from pfile='d:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1\database\initDUPLO.ora';
Datei erstellt.
Abgelaufen: 00:00:00.21
SQL >shu immediate
Datenbank geschlossen.
Datenbank dismounted.
ORACLE-Instanz heruntergefahren.
SQL >
Ohne den Alias auf das spfile hätte hier die Pfadangabe auf das bestehende spfile mit dem OMF-Namen erfolgen müssen. Zum Beispiel:
SQL >create spfile='+DATA/DUPLO/PARAMETERFILE/spfile.303.817894325' from pfile='d:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1\database\initDUPLO.ora';
3. Ab in den Cluster
Jetzt wird zunächst das ORACLE_HOME aufs Grid geschwenkt und die Datenbank registriert:
D:\>set ORACLE_HOME=D:\oragrid\11.2.0.3
D:\>srvctl add database -d DUPLO -o d:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1\
Die Prüfung der Konfiguration ergibt, dass die DB registriert ist, aber keine Datenbankinstanzen besitzt.
D:\>srvctl config database -d DUPLO
Eindeutiger Datenbankname: DUPLO
Datenbankname:
Oracle-Standardverzeichnis: d:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1\
Oracle-Benutzer: nt authority\system
Spfile:
Domain:
Startoptionen: open
Stoppoptionen: immediate
Datenbankrolle: PRIMARY
Verwaltungs-Policy: AUTOMATIC
Server-Pools: DUPLO
Datenbankinstanzen:
Datenträgergruppen:
Mount Point-Pfade:
Services:
Typ: RAC
Die Datenbank ist administratorverwaltet
D:\>
Die Registrierung der Datenbankinstanzen ist der nächste Schritt. Die notwendige Syntax erhält man von SRVCTL, wenn man mit ihm spricht:
D:\>srvctl add instance -h
Fügt eine Datenbankinstanzkonfiguration zu Oracle Clusterware hinzu.
Verwendung: srvctl add instance -d -i -n [-f]
-d Eindeutiger Name für die Datenbank
-i Instanzname
-n Knotenname
-f Hinzufügen-Vorgang erzwingen, selbst wenn einige Ressourcen gestoppt werden
-h Verwendung drucken
Kommunikation ist eben alles. ;)
Man kann sich übrigens mit fast allen Oracle-Kommadozeilenprogrammen so angeregt unterhalten und spart sich auf diese Weise den zeitraubenden Blick in Handbücher.
D:\>srvctl add instance -d DUPLO -i DUPLO1 -n racnode01
D:\>srvctl add instance -d DUPLO -i DUPLO2 -n racnode02
Das must have (2)
Jetzt sagen wir der DB noch schnell, wo das spfile - bzw. sein Alias - liegt:
D:\>srvctl modify database -d duplo -p +DATA/duplo/spfileduplo.ora
Konfiguration prüfen:
D:\>srvctl config database -d DUPLO
Eindeutiger Datenbankname: DUPLO
Datenbankname:
Oracle-Standardverzeichnis: d:\oracle\product\11.2.0.3\dbhome_1\
Oracle-Benutzer: nt authority\system
Spfile: +DATA/duplo/spfileduplo.ora
Domain:
Startoptionen: open
Stoppoptionen: immediate
Datenbankrolle: PRIMARY
Verwaltungs-Policy: AUTOMATIC
Server-Pools: DUPLO
Datenbankinstanzen: DUPLO1,DUPLO2
Datenträgergruppen:
Mount Point-Pfade:
Services:
Typ: RAC
Die Datenbank ist administratorverwaltet
D:\>
Das spfile in der ASM ist bekannt und die Instanzen ebenfalls - perfekt.
Abschlussarbeiten und DB-Start
Jetzt sind beide Instanzen registriert, wie man sieht.
Die Instanzen kann man aber noch nicht starten. Hierfür sind noch zusätzliche Handgriffe zu erledigen.
- Auf jedem Knoten muss ein pfile für die jeweilige Instanz existieren.
- Jedes dieser pfiles kann auf "seine" Instanz angepasst sein. Es ist beispielsweise möglich, jeder Instanz unterschiedliche Mengen an Speicher zur Verfügung zu stellen. Best Practice ist aber: Alle Knoten sind möglichst identisch konfiguriert.
- Die pfiles benötigen den Pfad zum gemeinsamen spfile in der ASM.
Aus 1 mach 2 (2)
Zunächst wird also auf jedem Knoten unter %ORACLE_HOME%/database ein pfile angelegt. Die pfiles sind einfache eine Kopie des bisher verwendeten pfile mit dem jeweiligen Instanznamen:
- Knoten 1: initDUPLO.ora -> initDUPLO1.ora
- Knoten 2: initDUPLO.ora -> initDUPLO2.ora
Der Pfad zum spfile wird ganz am Ende des pfiles eingetragen:
#initDUPLO.ora
### notwendige Parameter ###
db_name='DUPLO'
...
...
SPFILE='+DATA/duplo/spfileduplo.ora'
Ein pfile, das nur den Verweis auf das spfile in der ASM enthält, reicht auch aus.
Fazit
Im Prinzip ganz einfach. Man muss es nur machen.:)
Das Clonen von RAC-DB in anderen Konstellationen - z.B. von einem RAC auf einen zweiten Cluster - funktioniert in leicht abgewandelter Form, wenn man das backup based duplicate durchführt.
Leider ist das Duplizieren "from active database" nicht so einfach, weil es da nicht ausreicht, sich per
External User Authentication mit der DB zu verbinden.